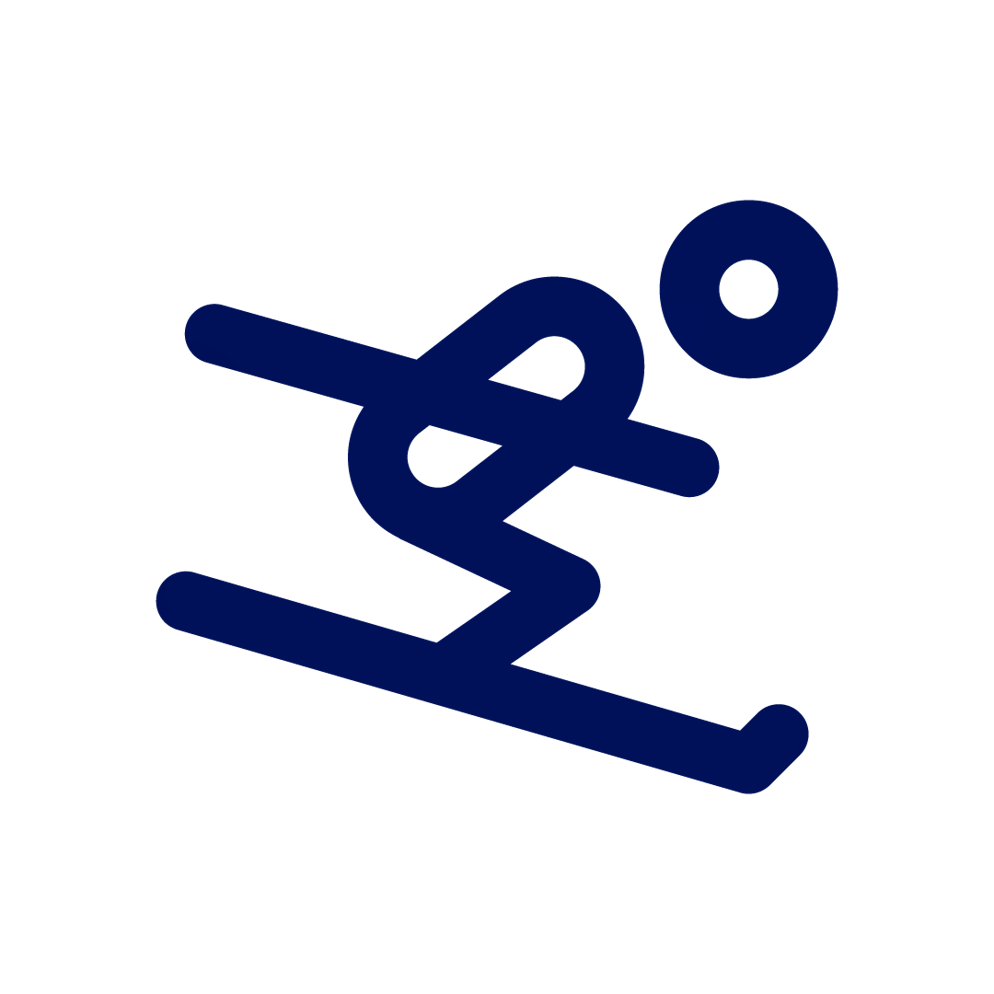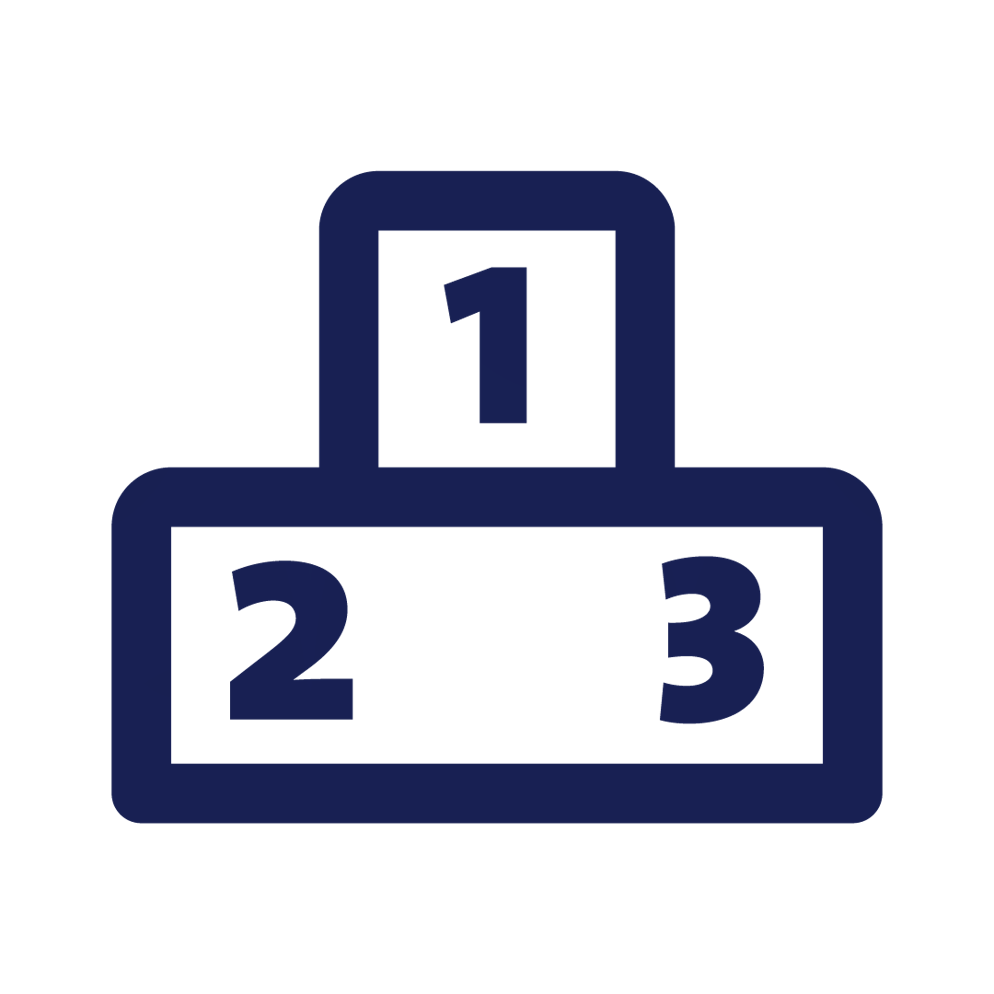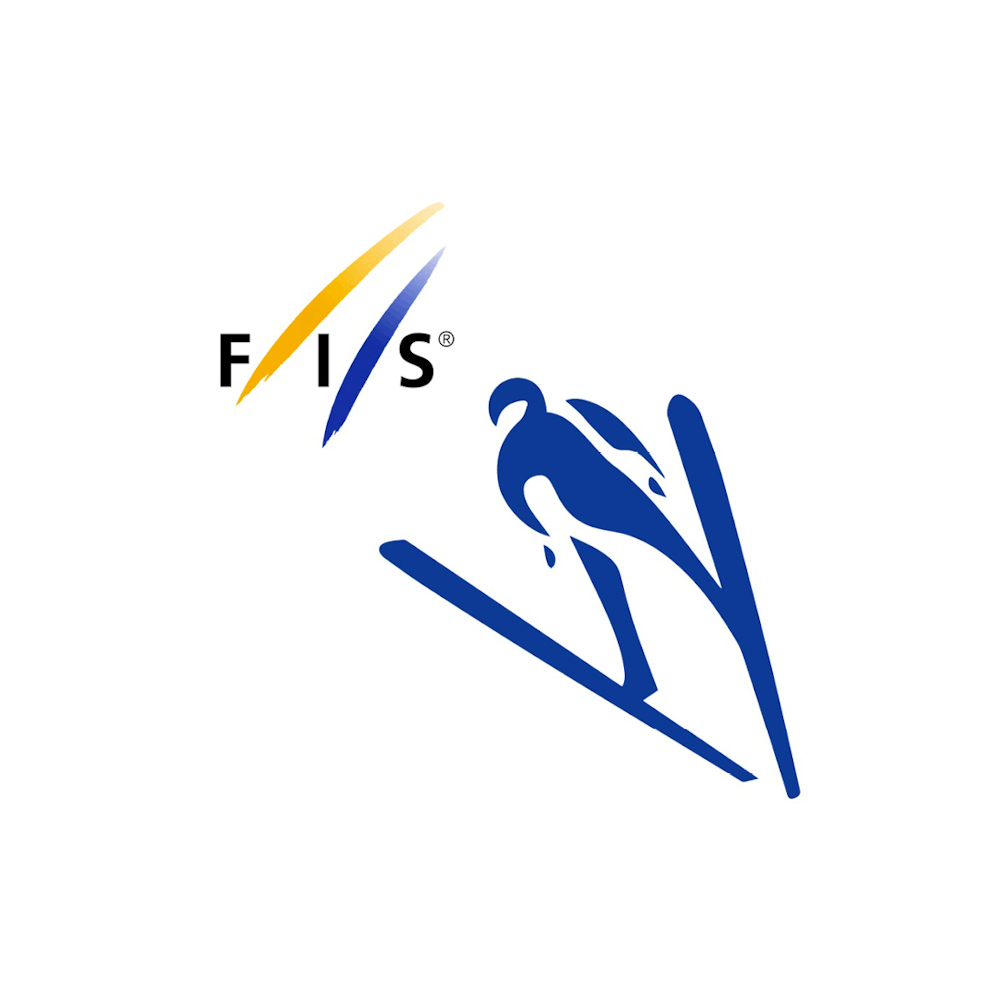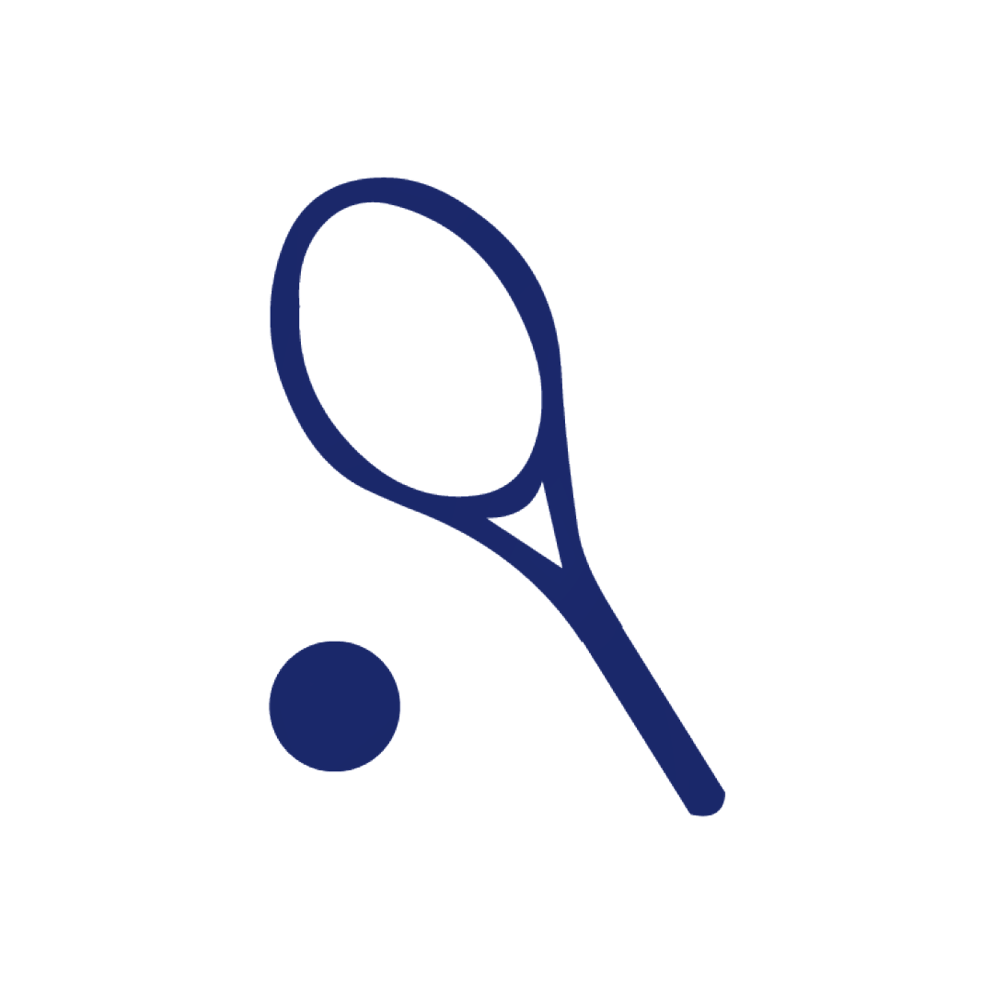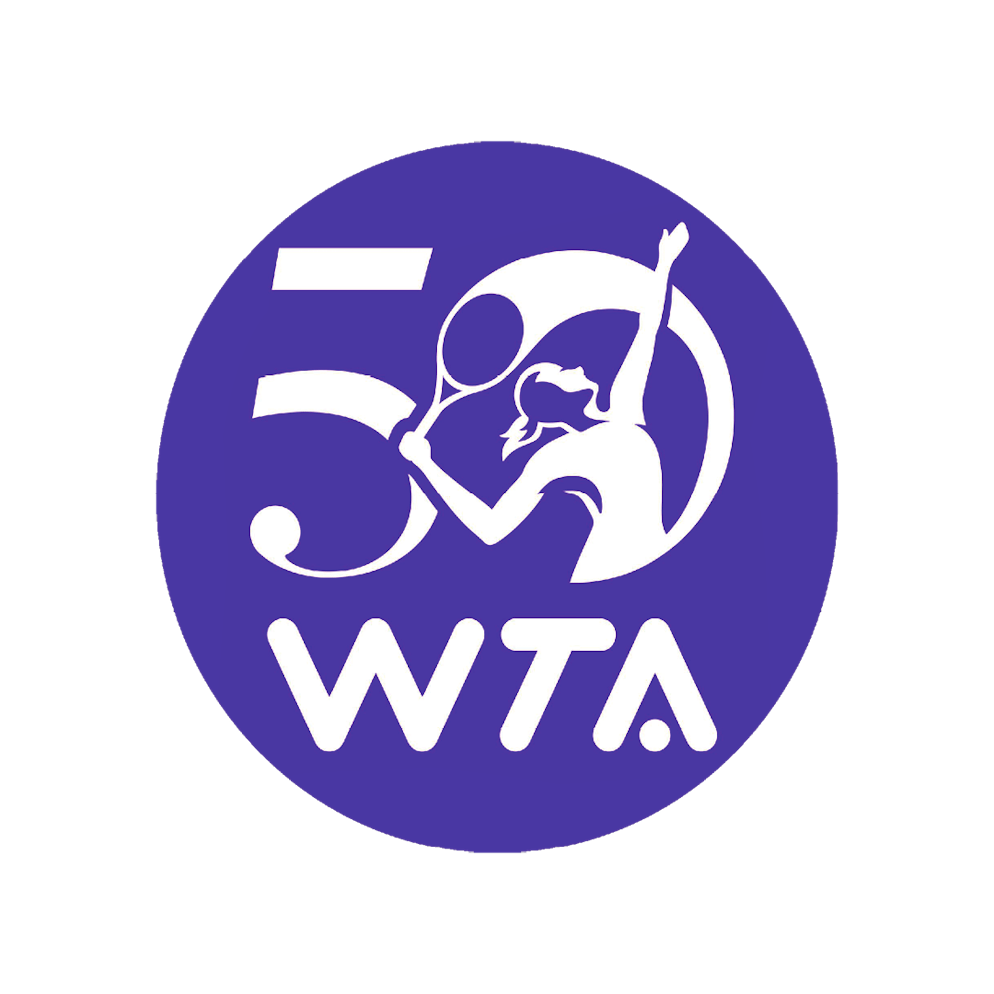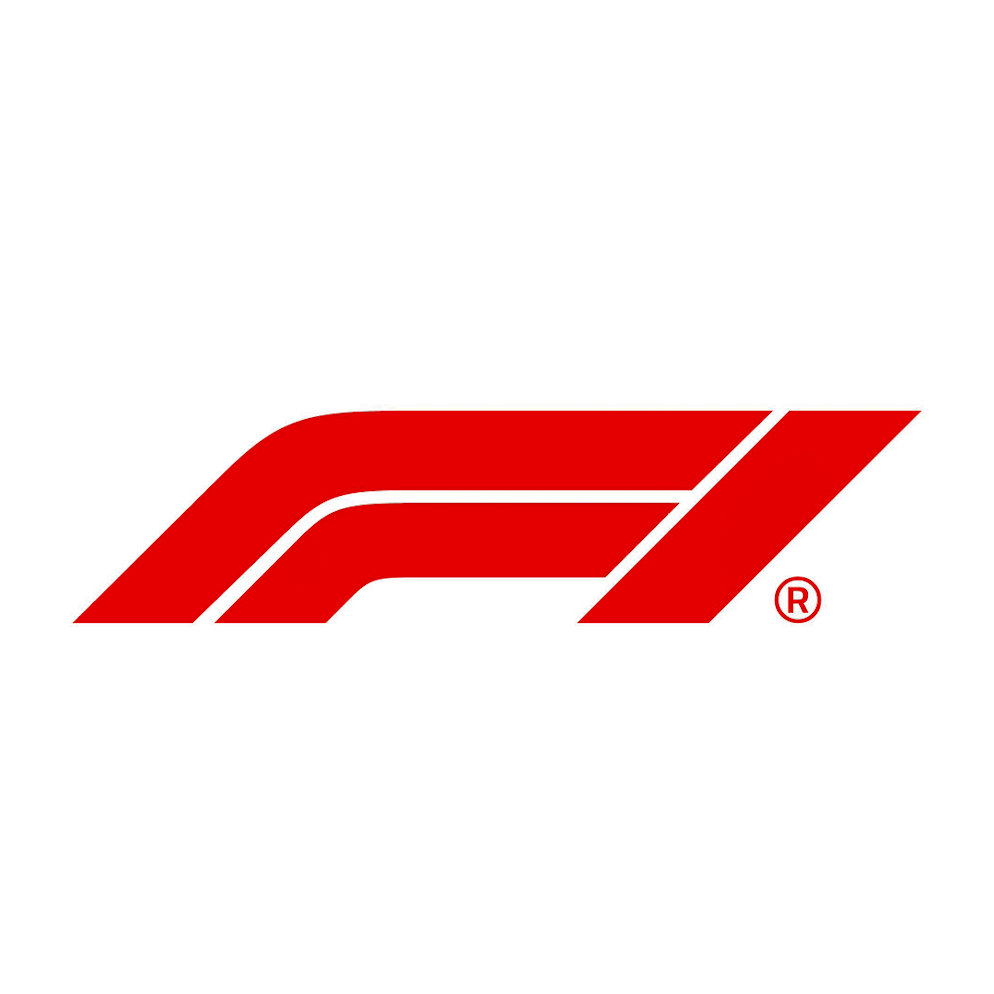Eine der vermissten Personen nach Unwetter im Misox GR tot geborgen
Eine der drei seit dem heftigen Gewitter am Freitagabend im Bündner Misox-Tal vermissten Personen ist am Sonntag tot geborgen worden, wie die Behörden am Sonntag an einer Medienkonferenz in Roveredo GR sagten.
23.06.2024
Im Misox haben schwere Unwetter verheerende Schäden angerichtet. Ein Murgang zerstörte in Sorte GR drei Häuser. Wie eine solche Gerölllawine überhaupt entstehen kann? Ein Experte klärt auf.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Im Misox kam es aufgrund heftiger Unwetter zu einer schweren Gerölllawine. Ausserdem brachte der intensive Regenfall den Fluss Moesa zum Überlaufen.
- Die Schäden sind immens: Ein ganzer Weiler und Teile der Nationalstrasse A13 wurden mitgerissen.
- Mittlerweile wurde eine Person tot geborgen, eine Frau konnte gerettet werden.
- Ein Experte erklärt, wie ein Murgang entsteht und ob wir in Zukunft mit mehr solchen Ereignissen hierzulande rechnen müssen.
Im Kanton Graubünden hat die Natur all ihre Gewalt gezeigt: Heftige Regenfälle haben einen Murgang ausgelöst und den Fluss Moesa zum Überlaufen gebracht. Der Weiler Sorte GR wurde grossteils zerstört, ausserdem wurden vom Hochwasser Teile der Nationalstrasse A13 mitgerissen. Eine Person ist mittlerweile tot geborgen worden, eine weitere Frau konnte aus dem Schutt gerettet werden.
Wie eine solch heftige Gerölllawine ausgelöst wird, erklärt Prof. Dr. Alexander Puzrin von der ETH Zürich im Interview mit blue News. Er ist Experte für Geomechanik und Geosysteme. Ausserdem weiss Puzrin, wie sich der Klimawandel auf solche Ereignisse auswirkt.
Wie entsteht ein Murgang überhaupt?
Durch die Schwerkraft bedingt bewegt sich Sediment an einem Hang abwärts. Doch die Reibung sorgt dafür, dass der Boden an Ort und Stelle bleibt. Die Schwerkraft ist die treibende Kraft und die Reibung beziehungsweise Scherfestigkeit ist die rückhaltende Kraft. Da Letztere von der Grundwasserströmung abhängt und dieser bei starkem Regen ansteigt, kommt es zu einem reduzierten Widerstand.
Wenn also zu viel Wasser vorhanden ist, dann ist die Reibung nicht mehr ausreichend – und das Sediment löst sich, rollt nach unten.
Ist die betroffene Region anfällig für diese Art von Katastrophe?
Auf jeden Fall. Wir haben hier ein schwieriges Gelände vorliegen. Für eine Gerölllawine braucht es einen Hang. Und in Graubünden gibt es viele, viele Hänge. Wenn zudem das Material, aus dem der Hang besteht, kein fester Fels ist, sondern aus verschiedenen Arten von Sedimenten besteht, liegt ein instabiler Boden vor. Sind also von grossen über kleine Steine bis hin zu Schotter, Sand und Ton unterschiedliche Bodensätze zu finden, kann das besonders dann riskant werden, wenn es zu starken Niederschlägen kommt.
In Graubünden und auch vielen anderen Regionen der Schweiz kommen solche Kombinationen aus steilen Hängen und relativ schwachen Ablagerungen vor, sodass die Gefahr von Erdrutschen sowie Gerölllawinen gross ist.
War es absehbar, dass es bei den aktuellen Wetterverhältnissen zu einer Gerölllawine kommen könnte?
Es hat in kurzer Zeit sehr, sehr viel und intensiv geregnet. Ich glaube, es waren etwa 125 Millimeter an einem Tag, wobei die monatliche Norm im Juni bei 154 Millimetern liegt. Wenn dieselbe Regenmenge über einen längeren Zeitraum hinweg fällt, hat das nicht die gleichen Auswirkungen, denn dann hat das Wasser Zeit, abzufliessen, und es wäre nicht zu einer so starken Strömung innerhalb des sehr durchlässigen Sediments gekommen. Der starke und intensive Regen war also das Problem.
Durch ausführliche Überwachung und Analysen könnten Expert*innen Vorhersagen treffen, aber es ist unmöglich, das ganze Land mit so vielen Bergen zu erfassen.
Führt der Klimawandel dazu, dass es in Zukunft mehr solche Katastrophen in der Schweiz geben wird?
Der Klimawandel hat in den Bergregionen eine doppelte Wirkung: Zum einen steigen die Temperaturen an und zum anderen kommen konzentriertere und intensivere Ereignisse häufiger vor. Heisst, dass es über das Jahr hinweg wahrscheinlich nicht mehr regnet, aber es stattdessen zu mehr starken Regenereignisse kommt. Und in den Zeiten dazwischen ist es relativ trocken.
Diese intensiven Ereignisse – wie wir sie gerade erleben – sind nicht gut. Andererseits sind sie auch nicht für alle Böden gleich schlecht, denn bei einigen Arten von Sedimenten, die nicht sehr durchlässig sind, fliesst bei starkem Regen ein grosser Teil des Wassers einfach vom Hang ab, ohne in den Boden einzudringen. Die höheren Temperaturen können wiederum Auswirkung darauf haben, dass Wassermengen von der Oberfläche verdunsten, anstatt in den Hang einzudringen, und somit die Hangstabilität nicht abgeschwächt wird.
Wir können also nicht direkt sagen, dass der Klimawandel Hangrutsche begünstigen wird. Für die Art von Gerölllawine, die wir in Graubünden gesehen haben, ist der Klimawandel jedoch nicht gut, sondern sorgt für ein grösseres Risiko.
Mehr Videos aus dem Ressort
Unwetter: Noch drei Vermisste in der Schweiz
Nach schweren Unwettern sind im Schweizer Kanton Graubünden im Südosten des Landes vier Menschen verschüttet worden. Eine Frau habe am Samstagmorgen aus dem Schuttkegel bei dem Ort Lostallo nördlich des Comer Sees lebend gerettet werden können.
22.06.2024